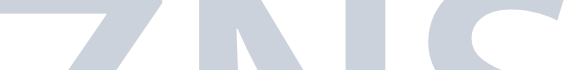Mit einem nichtmedikamentösen Versorgungsansatz allein ist es nicht getan
Die AOK hat ihren Pflegereport 2017 veröffentlicht. Dieser weist aus, dass 40% der Heimbewohner ein Neuroleptikum und 30% ein Antidepressivum erhalten. Dies wird als eine unnötige Verordnung und Überverordnung von Psychopharmaka gewertet. Laut AOK-Chef Martin Litsch sind die behandelnden Ärzte und Pflegeheimbetreiber in der Pflicht, Medikamente nur dann einzusetzen, wenn es nicht anders geht. Der Spitzenverband ZNS (SpiZ) fordert hier eine differenziertere Bewertung der Situation.
Die Förderung nichtmedikamentöser Versorgungsansätze begrüßen wir außerordentlich. Sie sind aber kein Allheilmittel. Wenn demente Patienten krankheitsbedingt verhaltensauffällig werden, z.B. Weglauftendenzen haben, ihre Aggressionen nicht kontrollieren können oder das Nachbarzimmer mit der Toilette verwechseln, haben wir es mit entwürdigenden Situationen für die Patienten selbst zu tun. Aber auch die emotionale Belastung der Mitarbeiter und der Angehörigen ist immens. Medikamente können richtig eingesetzt dazu beitragen, die Würde wiederherzustellen, erklärt der Präsident des Spitzenverbands ZNS, Dr. Uwe Meier.
Mit der Beschreibung und Bewertung des Verordnungsverhaltens ist es allerdings nicht getan. Vielmehr müssen die Gründe hierfür ebenfalls analysiert werden. Heime stehen unter einem erheblichen wirtschaftlichen Druck. Geringe Personalschlüssel können nur durch ein großes Engagement der Pflegekräfte kompensiert werden. Die menschliche Zuwendung bleibt dann auf der Strecke, betont Dr. Sabine Köhler, Mitglied des SpiZ und kommissarische Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Nervenärzte.
Eine Medikamentengruppe hier als Ganzes zu brandmarken ist da wenig hilfreich. Niemand kann wirklich die Zeit herbeisehnen, als es diese Medikamente noch nicht gab. Gleichwohl sollte der Einsatz von Psychopharmaka nicht das Ziel haben, strukturelle Defizite von Heimen auszugleichen. In diesem Sinne halten wir den AOK-Pflegereport für richtungsweisend und eine Chance, dass Kostenträger, Pflegeheimbetreiber und Ärzte gemeinsam Modelle erarbeiten, alternative Versorgungsmodelle zu entwickeln. Ohne die Bereitschaft von Kostenträgern die medizinisch dringend notwendige Verbesserung der Zuwendungsmedizin zu finanzieren, wird dies allerdings nicht gelingen, betont Dr. Christa Roth-Sackenheim, ebenfalls Mitglied des SpiZ und Vorsitzende des Berufsverbands deutscher Psychiater.